Trauer und Wut
Trauer ist ein ganz starker Gefühlszustand, der das Leben deutlich bestimmt und dazu auch soziokulturell stark reglementiert wird. Obwohl der Wunsch nach einer Veränderung des Umgangs mit Tod und Trauer in Deutschland da ist, sind viele Trauernde dann aber doch mit konservativen Vorurteilen und Verhaltensregeln konfrontiert. „Über Tote spricht man nicht schlecht“ ist ein Glaubenssatz, der vernünftig klingt, denn im Prinzip sollte man auch über Lebende nicht schlecht reden.
Wenn sich dieser Satz aber verselbstständigt in etwas wie „Ich darf nicht wütend sein“ oder „Ich darf nicht einmal daran denken, wütend zu sein“ ist das eine innere Maßregel, der zum einen nicht funktioniert und zum anderen ein Gefühl wegdrückt, in dem unheimlich viel Energie steckt. Wut und Trauer, das gehört oft zusammen, eben nicht nur im klassische Wut-Trauerfall Suizid, wo der Verlustschmerz sich abwechselt mit dem Unglauben, dass der Verstorbene sich von einem nicht anvertrauen oder sich helfen lassen wollte.
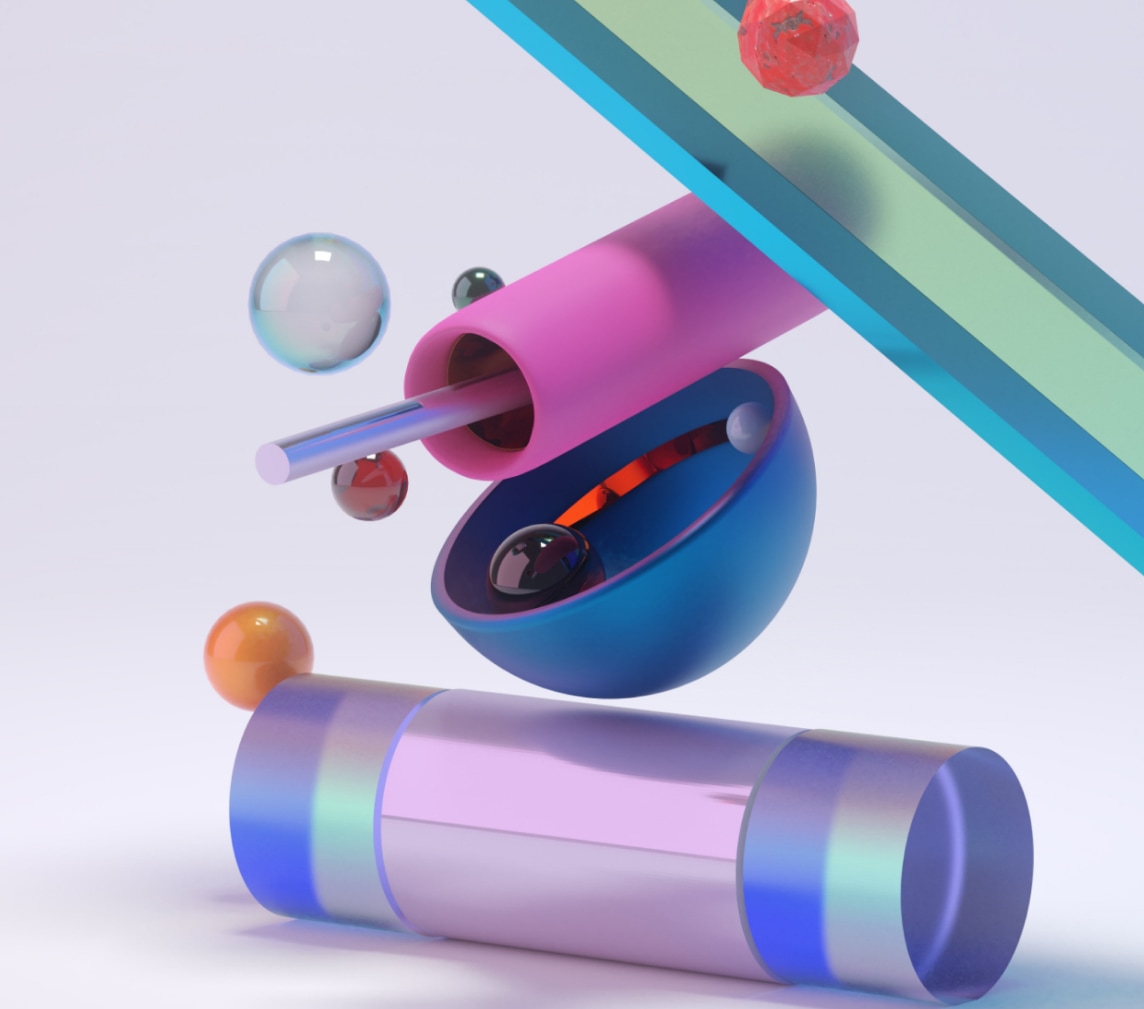
Es ist eine klare Abrechnung
Jeder Verlust trägt ein Wutpotential in sich. Es ist die klare Definition einer Summe des Vorher zum Nachher. Und wenn da ein Minus steht, weil nun jemand „verloren“ ist, dann fühlt sich der Trauernde unfair behandelt, vom Schicksal und aber auch vom Verstorbenen, der ja nun einfach weg ist und einen dadurch erst in diese Situation gebracht hat. Das muss objektiv überhaupt nicht stimmen, ist aber als Gefühl in dem Moment wahr, in dem es gefühlt wird. Und dadurch hat die Wut auch eine Daseinsberechtigung. Da hilft auch kein Ignorieren oder noch schlimmer: weglächeln.

Darf man auf Verstorbene wütend sein?
Wut ist ist im Trauerkontext gesellschaftlich „erlaubt“, sobald es sich um ein Schuldthema handelt: Ein Gewaltverbrechen mit Todesfolge – wer hier nicht wütend ist, fällt auf. Oder ein Behandlungsfehler? Die Schuld am Verlust ist hier einfach zu vergeben. Das tut erst mal gut, denn es gibt offenbar einen Verantwortlichen. Der Effekt hält aber nur kurz an, denn diese Wut ist so grell, dass sie eventuell die Trauer überdecken kann. Dann hält sie den Trauernden weiter am Laufen, aber nur solange der weiter wütend ist. Ein Abbau der Wut oder ein Verzeihen wäre in diesem Zustand gefühlt die Aufgabe des Lebens. Der Kampf gegen die Schuldigen hält den Trauernden in der Zwischenwelt des „nicht wahrhaben-Wollens“ ein Verzeihen ist dann das innere Eingeständnis dass der andere für immer fort ist.
Es ist einfach, Schuld zu geben, wo klare Fehler passiert sind. Anders sieht es aus, wenn eine Mutter ihr ungeborenes Baby in der Schwangerschaft verliert, einfach so, ohne sichtbaren Grund. Sie wird möglicherweise die Schuld bei sich suchen, wütend sein auf ihren Körper, der dem Kind kein gutes Zuhause war. Die Wut richtet die Trauernde nun gegen sich selbst.
